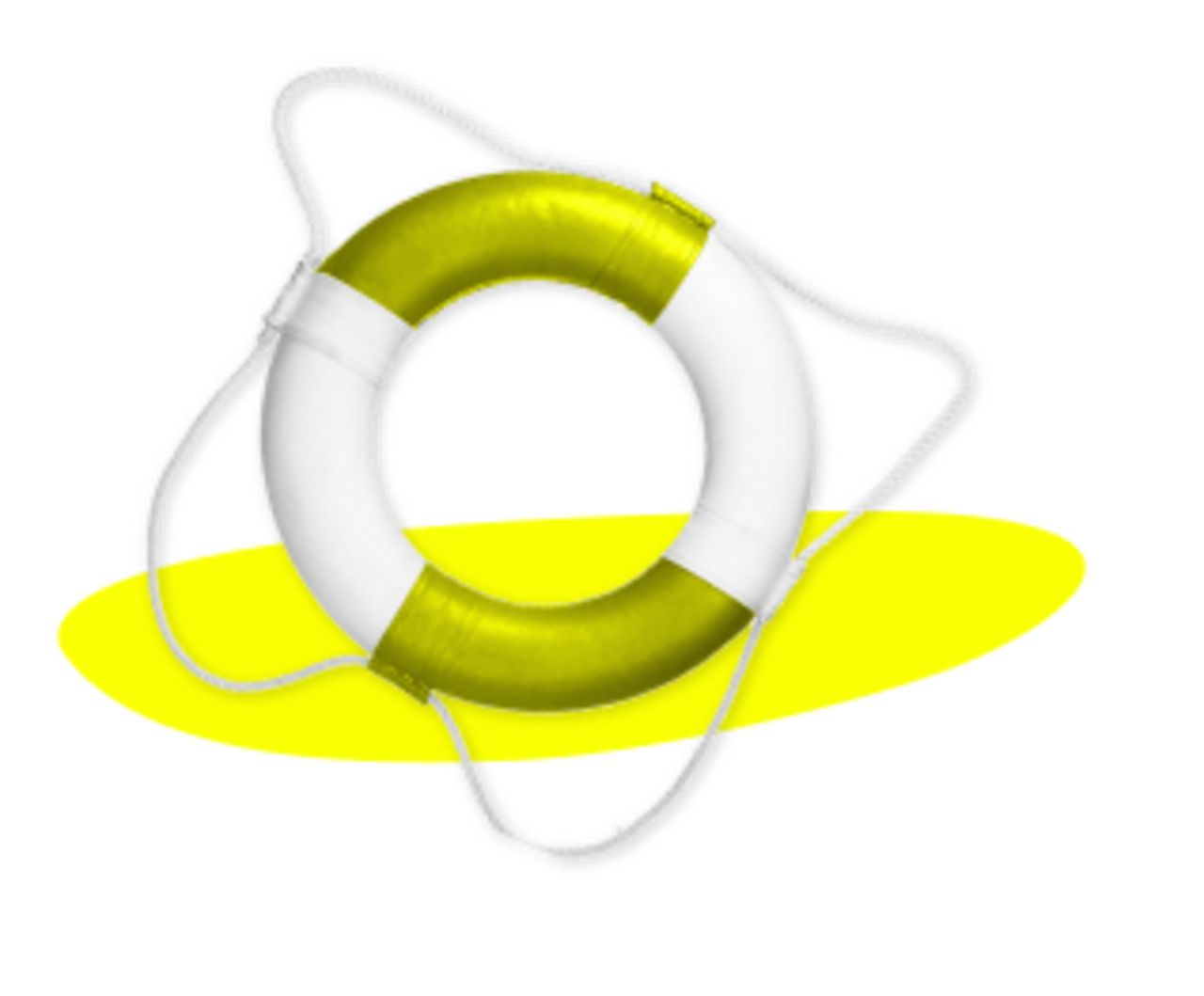Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
Erlebt eine Person ein traumatisches Ereignis, kann sie das völlig aus der Bahn werfen – es kann zu einer sogenannten Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) kommen. Auf dieser Seite finden Sie verständliche Informationen rund um traumatische Belastungen, ihre Entstehung und Tipps zur Bewältigung im (Berufs-)Alltag.
Im modernen Sprachgebrauch finden Begriffe wie „traumatisch“ oder “triggern” immer häufiger Verwendung. In der Psychologie wird dann von „Trauma“ oder „traumatischen Ereignissen“ gesprochen, wenn einen Menschen etwas völlig aus der Bahn wirft: Betroffene erleben eine psychische Ausnahmesituation, ausgelöst durch ein überwältigendes Ereignis (z. B. ein schwerer Unfall, eine Gewalttat, eine (Natur-)Katastrophe, Missbrauch oder Krieg). Traumatische Ereignisse sind zum Glück selten, können aber starke Folgen für die Psyche haben: Es kann zu einer sogenannten Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) kommen.
Selbst wenn ein traumatisches Ereignis nicht unmittelbar im Arbeitskontext geschieht (z. B. in Form eines Arbeitsunfalls oder Einsatzes), kann sich die extreme Belastung der Betroffenen stark auf ihre Arbeitsfähigkeit auswirken. Deshalb sollten sich auch Organisationen und Unternehmen mit den Auswirkungen von Traumata und der Unterstützung von Betroffenen auseinandersetzen.
Ziel dieser Seite ist es, die wichtigsten Informationen im Kontext traumatischer Belastungen darzustellen, die PTBS besser zu verstehen und den betrieblichen Umgang damit zu erleichtern.
Quelle: DGPPN Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V.
PTBS FAQ
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine psychische Erkrankung, die als Folge auf ein sogenanntes Trauma (also eine schwere Belastung bzw. Bedrohung) auftritt. Ein solches Trauma kann über einen längeren Zeitraum stattfinden, beispielsweise wenn eine Person einen Krieg miterlebt. Manchmal wiederholen sich traumatische Erlebnisse über einen längeren Zeitraum, z. B. bei sexuellem Missbrauch oder anderen Gewalterfahrungen. Es kann sich aber auch um ein einmaliges Ereignis handeln, wie z. B. ein schwerer Autounfall oder ein Überfall.
Typisch für diese psychische Erkrankung ist, dass das Erlebte die Betroffenen nicht loslässt und die belastenden Erinnerungen immer wiederkehren. Eine PTBS kann die Betroffenen auch noch Jahre nach dem Erlebten beeinträchtigen: So können das Familienleben, die Ausübung des Berufes oder soziale Beziehungen stark beeinträchtigt werden.
Laut ICD-11 tritt eine PTBS in der Regel innerhalb von 3 Monaten nach dem traumatischen Ereignis auf. In manchen Fällen kann eine PTBS erst viele Jahre nach dem traumatischen Ereignis auftreten.
Den Betroffenen helfen in der Regel die Unterstützung des sozialen Umfelds sowie eine Psychotherapie (siehe unten), die bei der Bewältigung der traumatischen Erfahrungen unterstützt.
Quellen: gesund.bund.de (Bundesministeriums für Gesundheit), www.springermedizin.de, World Health Organization (WHO)
Voraussetzung für die Diagnose einer PTBS ist das Vorliegen eines schweren Traumas. Eine “klassische PTBS” ist gekennzeichnet durch folgende Symptome:
- Wiedererleben: Betroffene „durchleben“ das Trauma erneut in Form von lebendigen Erinnerungen (Flashbacks), Rückblenden oder Albträumen. Dieses Wiedererleben kann über einen oder mehrere Sinne erfolgen, d.h. Betroffene können das in der Vergangenheit Erlebte z. B. sehen (innere Bilder), riechen, schmecken, hören oder fühlen.
- Vermeidungsverhalten: Betroffene vermeiden Situationen, Orte oder Menschen, die an das Erlebte erinnern.
- Anhaltende Wahrnehmung einer aktuellen Bedrohung: Betroffene leiden unter einem Gefühl der Bedrohung, ständig in Gefahr zu sein. Das kann sich äußern in einer verstärkten Schreckreaktion (z. B. auf unerwartete Geräusche) oder in einer erhöhten Wachsamkeit.
Eine PTBS kann diagnostiziert werden, wenn diese Symptome gemeinsam über mindestens vier Wochen lang anhalten und sie das Leben der Betroffenen erheblich beeinträchtigen.
Quellen: gesund.bund.de (Bundesministeriums für Gesundheit), www.springermedizin.de, World Health Organization (WHO)
Eine PTBS kann sich potentiell bei allen Personen entwickeln, die mit einem Trauma konfrontiert waren. Wichtig zu wissen ist: Diese Erkrankung ist eine normale Reaktion auf ein „unnormales Ereignis“. Ein traumatisches Erlebnis kann im Arbeitskontext (z. B. als Arbeitsunfall) oder im privaten Kontext passiert sein.
In Deutschland sind jährlich ca. 1,5 Millionen Erwachsene von einer akuten PTBS betroffen. Frauen erkranken dabei zwei- bis dreimal häufiger an einer PTBS als Männer, ältere Menschen tendenziell eher als jüngere. Schätzungen zufolge entwickeln etwa 2 bis 3 Prozent der Bevölkerung in Deutschland im Lauf ihres Lebens mindestens einmal eine PTBS.
Besonders gefährdet sind:
- Personen, die häufiger Grenzsituationen ausgesetzt sind: Das sind z. B. Beschäftigte der Polizei und Feuerwehr, Rettungssanitäter*innen , Lokführende, Soldaten, Journalist*innen in Krisengebieten oder auch Ärzt*innen und Psycholog*innen, die mit traumatisierten Menschen arbeiten.
- Psychisch vorbelastete Menschen: bei Personen, die unter Depression, Angststörung oder Suchterkrankung leiden, ist das Risiko für eine PTBS höher.
- Geflüchtete und Asylsuchende: Bei dieser Personengruppe ist das Risiko für PTBS zehnmal höher im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Schätzungen zufolge leiden in Deutschland 40 bis 50 von 100 Geflüchteten unter einer PTBS.
Nicht immer entwickelt eine Person, die ein Trauma erlebt hat, eine PTBS. Ob sich Folgen aus einem Trauma entwickeln, hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem
- von der Art des Traumas,
- von der Dauer des Traumas,
- davon, ob das Trauma wiederholt passierte,
- von individuellen Faktoren in der Person (z. B. Umgang mit Stress, psychische Ressourcen, psychische Vorerkrankungen),
- von der sozialen Unterstützung, die die Person erhält.
Quellen: gesund.bund.de (Bundesministeriums für Gesundheit), Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), psychenet – Hamburger Netz psychische Gesundheit
Starke Beschwerden einer PTBS beeinflussen oftmals massiv den Alltag der Betroffenen. Unter anderem Schlaf- und Konzentrationsschwierigkeiten können dazu führen, dass sie den beruflichen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Es zeigen sich womöglich
- lange Arbeitsunfähigkeitszeiten,
- Schwierigkeiten bei der Wiederaufnahme der Tätigkeit,
- Vermeidungsverhalten gegenüber bestimmten (Teil-)Tätigkeiten,
- Rückzugsverhalten gegenüber Kolleg*innen,
- Verhaltensauffälligkeiten (z. B. Suchtgefährdung) oder gar
- Berufs-, Tätigkeitsaufgabe, Berufsunfähigkeit.
Auch ist es möglich, dass Betroffene am Arbeitsplatz wiederholt „getriggert“, also an das traumatische Erlebnis erinnert werden . Einige Betroffene von PTBS sind über längere Zeit nicht arbeitsfähig. Andere arbeiten weiter und tragen lange Zeit die schwere Traumatisierung als „stillen Kampf“ mit sich, ohne dass das betriebliche Umfeld davon erfährt. Die meisten Menschen, die ein Trauma erlebten, verarbeiten das Erlebte nach einiger Zeit. Bis dahin sind in der Regel jedoch viel Unterstützung, Zuwendung und Zeit notwendig – auch im betrieblichen Kontext.
Quellen: gesund.bund.de (Bundesministeriums für Gesundheit), Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW); Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Auch im betrieblichen Kontext können – wenn auch zum Glück selten – traumatische Ereignisse auftreten. Arbeitgebende haben Pflichten, sich mit dem Thema auseinander zu setzen:
- Arbeitgebende tragen die Fürsorgepflicht für ihre Beschäftigten, d. h. Sorge für die Gesundheit und das Wohlergehen.
- Arbeitgebende habe eine Meldepflicht, wenn ein Arbeitsunfall eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder den Tod eines Beschäftigten zur Folge hat.
- Arbeitgebende müssen eine Gefährdungsbeurteilung durchführen; auch für Gefährdungen durch traumatische Ereignisse.
Zudem sollten sich Betriebe auf mögliche traumatische Ereignisse im Arbeitskontext vorbereiten (wie z. B. Arbeitsunfälle, Übergriffe oder sonstige belastende Situationen), um im Ernstfall professionell reagieren zu können. Tipps zum Umgang mit traumatischen Ereignissen im Betrieb finden Sie hier von der DGUV.
Quellen: gesund.bund.de (Bundesministeriums für Gesundheit), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Nicht jede PTBS verläuft gleich; wie genau eine PTBS verläuft und wie das Erlebte verarbeitet wird, hängt von vielen Faktoren ab, u. a. von der Schwere und der Art des Traumas. Symptome einer PTBS verlaufen oft über mehrere Monate oder auch Jahre.
Erste Beschwerden können schon kurz nach dem traumatischen Erlebnis auftreten, manchmal aber auch erst Jahre später. Es kann z. B. sein, dass eine Person erst im höheren Alter eine PTBS durch ein Kriegstrauma aus der Kindheit entwickelt.
In etwa 30 von 100 Fällen halten die Beschwerden 3 Jahre oder länger an und können chronisch werden. Diese Menschen neigen häufig zu weiteren psychischen Beschwerden, wie z. B. Suchterkrankungen.
In vielen Fällen verschwinden die PTBS-Beschwerden nach einiger Zeit wieder. Dann verarbeiten Menschen das Erlebte; das traumatische Ereignis wird zur „normalen“ Erinnerung und nicht mehr als belastend empfunden.
Quellen: gesund.bund.de (Bundesministeriums für Gesundheit), Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)
Die Ursache für eine PTBS ist ein sogenanntes Trauma. Ein Trauma ist ein überwältigendes, lebensbedrohliches Ereignis, wie z. B. ein schwerer (Arbeits-)Unfall, eine Gewalttat, eine Katastrophe oder Krieg. Bei einem Trauma erleben Betroffene eine psychische Ausnahmesituation.
Ein solches Trauma kann
- einmalig auftreten, wie z. B. ein schwerer Arbeitsunfall, Autounfall, Überfall oder ein medizinischer Notfall
- über einen längeren Zeitraum stattfinden, z. B. Miterleben eines Krieges, oder
- sich über einen längeren Zeitraum wiederholen, z. B. bei Gewalterfahrungen oder sexuellem Missbrauch.
Bestimmte Berufsgruppen sind eher mit Traumata, also dramatischen Ereignissen, konfrontiert. Dazu zählen z. B. Beschäftigte der Polizei und Feuerwehr, Rettungssanitäter*innen, Lokführende, Soldat*innen und Journalist*innen in Krisengebieten. Für Rettungssanitäter*innen ist PTBS bereits als Berufskrankheit vom Bundessozialgericht anerkennungsfähig.
Quelle: Deutsches Ärzteblatt; gesund.bund.de (Bundesministeriums für Gesundheit), Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)
Eine PTBS lässt sich in der Regel gut behandeln. Wenn die Symptome einer PTBS länger als vier Wochen anhalten, sollte eine Beratung durch Fachpersonen (z. B. Hausärzt*innen, Psychotherapeut*innen oder andere Anlaufstellen) erfolgen.
Am wirksamsten bei PTBS ist die Psychotherapie: Sie bietet einen geschützten Rahmen, um über die traumatischen Erinnerungen und die Beschwerden zu sprechen. Bei der traumafokussierten kognitiven Verhaltenstherapie lernen Betroffene zum Beispiel, sich der belastenden Situation zu stellen. Die Selbstheilungskräfte werden aktiviert und Gedanken oder Gefühle, die mit der traumatischen Situation besetzt sind, sollen neu bewertet werden.
In manchen Fällen können ergänzend zur Psychotherapie Medikamente (Psychopharmaka) sinnvoll sein. Das schätzt die oder der behandelnde Ärzt*in ein.
Quellen: gesund.bund.de (Bundesministeriums für Gesundheit), Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW); Deutsche Gesellschaft für Traumatherapie (DeGPT)
Die Unterstützung durch Kolleg*innen und Führungskräfte ist für Betroffene mit PTBS sehr wichtig: Hören Sie Betroffenen gut zu, fragen Sie sie, wie es ihnen geht und vor allem, was sie gerade brauchen. Insbesondere in Berufen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für traumatische Ereignisse ist es wichtig, dass Kolleg*innen und Führungskräfte mit wachen Augen auf diejenigen achten, die von Einsätzen etc. zurückkehren. Die möglichen Symptome einer PTBS zu kennen, gibt Sicherheit im Umgang mit Personen, die möglicherweise an einer PTBS leiden.
Wenn Sie merken, dass jemand sich anders als vorher verhält, gehen Sie behutsam auf die Person zu und schildern Sie Ihre Sorgen. Bieten Sie ein Gespräch an. Eine positive Arbeitsumgebung kann dazu beitragen, dass sich die Person öffnet.
Tipps für ein Gespräch:
- Wählen Sie einen ruhigen Moment und einen angenehmen Raum.
- Stellen Sie sicher, dass die betroffene Person der Situation zustimmt.
- Sprechen Sie die Person alleine an, um ungestört reden zu können.
- Beginnen Sie das Gespräch, indem Sie die Person respektvoll nach ihrem Befinden fragen.
- Fragen Sie die Person, was sie gerade braucht.
- Hören Sie der Person aufmerksam zu. Wenn die Person nicht über ihre Probleme sprechen möchte, respektieren Sie das. Signalisieren Sie, dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt bereit für ein Gespräch sind. Sie können helfen, indem Sie Informationen bereitstellen. Ermutigen Sie die Person, sich professionelle Hilfe zu suchen. Betriebliche Sozialberatung, EAP , Selbsthilfegruppen, Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen oder externe Beratungs- und Anlaufstellen können unterstützen.
Quellen: gesund.bund.de (Bundesministeriums für Gesundheit), Bundesweh
Arbeitgebende sollten ein vertrauensvolles Arbeitsklima gestalten, damit sich die Beschäftigten trauen, offen über ihre Beeinträchtigungen zu sprechen. Nur dann können auch die Arbeitsbedingungen angepasst und die individuelle Situation verbessert werden.
Folgende interne Ansprechpersonen sollten besonders im Umgang mit Beschäftigten mit psychischen Beeinträchtigungen sensibilisiert werden:
- BEM-Team/ BEM-Beauftragte
- Betriebsärztin/-arzt
- Betriebs-/Personalrat bzw. Mitarbeitendenvertretung
- Personalverantwortliche Personen im Betrieb bzw. Führungskraft
- Schwerbehindertenvertretung (SBV)
- Sozialberatung
- EAP (Employee Assistance Program)
Ja. Das Betriebliche Eingliederungsmanagement hat die Wiederherstellung, den Erhalt und die Förderung der Arbeitsfähigkeit zum Ziel und möchte Arbeitsplätze erhalten. Sollten Betroffene innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig gewesen sein, dann sollte der Betrieb zu einem BEM einladen.
Informationen zum BEM finden Sie hier. Im Rahmen des BEM muss der Datenschutz gewährleistet sein und es herrscht absolute Vertraulichkeit.
Im Umgang mit PTBS-Betroffenen seitens Kolleg*innen, Führungskräften und Arbeitgebenden kann helfen:
- Offene Kommunikation: Ob, wann und wie Betroffene über ein Trauma sprechen wollen, ist individuell. Wenn Betroffene dies tun, sollten Kolleg*innen behutsam nachfragen, was die Bedürfnisse der Betroffenen sind. Z. B. kann eine offene Kommunikation über persönliche Trigger der Betroffenen die Zusammenarbeit erleichtern.
- Empathie und Verständnis für verändertes Verhalten: Einige Betroffene ziehen sich zurück oder können sich nicht mehr so gut ins Team integrieren. Hier sollten Kolleg*innen und Führungskräfte Verständnis zeigen. So können sich Betroffene an ihrem Arbeitsplatz sicher aufgehoben und rücksichtsvoll behandelt fühlen.
- Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice: PTBS-Betroffene leiden häufig unter Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Um das Arbeiten flexibel an den eigenen Rhythmus anpassen zu können, kann die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice eine enorme Entlastung für Betroffene sein. Sollte die Arbeit im Homeoffice nicht möglich sein, können Rückzugsmöglichkeiten im Büro helfen.
- Rahmenbedingungen: Soziale Unterstützung ist für die Gesundung generell wichtig. Insgesamt sollten Betriebe Rahmenbedingungen schaffen, die eine Traumatisierung zumindest nicht verschlechtern. So sollten z. B. in Branchen, in denen ein höheres Risiko für Traumata vorherrscht, Glaubenssätze wie „Da musst du als Ärzt*in/Soldat*in [etc.] eben durch“ hinterfragt werden.
- Unterstützungsangebote: Betriebliche Angebote, wie z. B. die Sozialberatung oder ein EAP , können Beschäftigte im Allgemeinen bei Problemen rund um Beruf, Gesundheit und Privatleben unterstützen.
Quellen: gesund.bund.de (Bundesministeriums für Gesundheit), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)